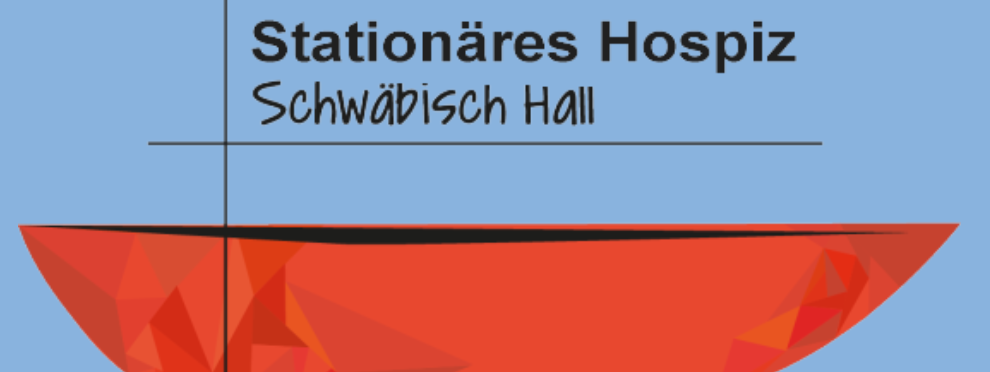
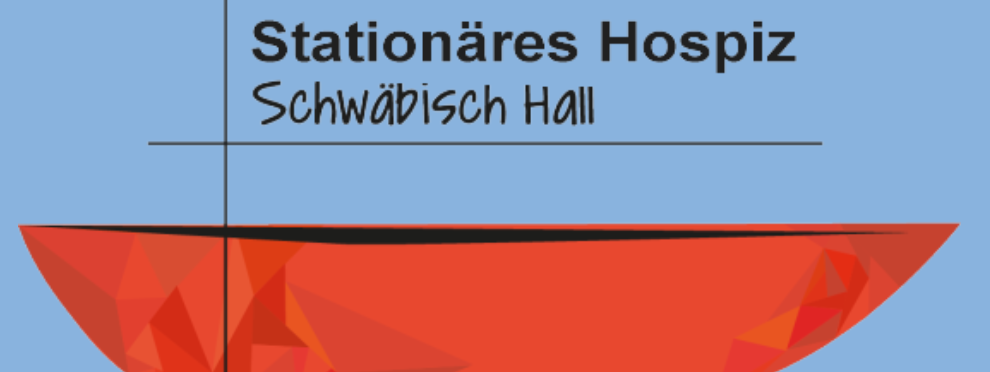
Seelsorge im Hospiz
Der Tod ist in einem Hospiz sehr präsent. Welche Rolle Seelsorge dabei spielen kann, zeigt die Startphase der neuen Einrichtung in Schwäbisch Hall.
Seit vergangenem Herbst werden Menschen im neuen stationären Hospiz in Schwäbisch Hall in der letzten Phase ihres Lebens betreut und begleitet. Dazu gehört auch ein seelsorgerliches Angebot. Das richtet sich nicht nur an diejenigen, die in der Einrichtung ihre letzten Lebenstage verbringen.
Gabriele Hüben-Rösch möchte auch den Beschäftigten des Hauses eine Möglichkeit schaffen, ihre Erfahrungen für sich bewusst zu verarbeiten. Hüben-Rösch hat zu ihrer Aufgabe als Krankenhausseelsorgerin die Seelsorge im neuen stationären Hospiz übernommen.
Das Konzept für die Seelsorge entwickelt sich parallel zu den Erfahrungen der Startphase. So fand zum Beispiel bereits eine Gedenkfeier statt, in der das Team des Hauses noch einmal für sich von den Verstorbenen Abschied nehmen konnte. Susanne Dutschmann, Palliative-Care-Pflegefachkraft, weiß das zu schätzen.

Oliver Kübler (Pflegedienstleitung), Seelsorgerin Gabriele Hüben-Rösch und Doro Herrmann (Kunsttherapeutin und Sterbe- und Trauerbegleiterin) im Raum der Stille im neuen stationären Hospiz in Schwäbisch Hall Foto: DRS/Guzy
Denn bereits in den ersten Betriebswochen zählte die Einrichtung 20 Todesfälle. Anfangs war die Verweildauer mit zwei bis vier Tagen sehr kurz, wie Oliver Kübler, der für die pflegerische Leitung verantwortlich ist, erklärt.
Das Hospiz bietet Platz für acht Gäste. So werden die Menschen genannt, die in der Einrichtung die letzte Lebensphase verbringen – mit der Chance, das anders als zuhause oder im Krankenhaus zu erleben, wie Hüben-Rösch erklärt. Von Mitte 40 bis Ende 80 reicht laut Kübler die Altersspanne der bisherigen Gäste. Ein onkologisches Krankheitsbild überwiege.
Der Schritt in die Einrichtung sei schwer, sagt Doro Herrmann. Sie hat sich viele Jahre im ambulanten Hospizdienst Schwäbisch Hall engagiert und arbeitet nun in der neuen stationären Einrichtung als Kunsttherapeutin und Sterbe- und Trauerbegleiterin. Sich klar zu werden, dass es die letzte Etappe im Leben ist, sei die Voraussetzung, ergänzt Hüben-Rösch: „Viele drängen das hinaus.“
Für die Angehörigen könne das Hospiz eine Entlastung sein, es können aber auch Schuldgefühle bei ihnen aufkommen, berichtet Herrmann. Hüben-Rösch und Herrmann stehen bei Gesprächsbedarf für alle bereit. Im Haus findet sich auch ein Raum der Stille. Geschwungene Holzlamellen verkleiden die Wände und geben dem Inneren eine organische Anmutung. Der Raum werde zum Beispiel von den Angehörigen aufgesucht, berichtet Kübler.
Bei der Begleitung in der Einrichtung gehe es darum, zu erspüren, was gebraucht werde, erklärt Hüben-Rösch. So erteilt die Seelsorgerin, wenn es die Angehörigen wünschen, einen Sterbesegen oder bringt die Krankenkommunion.
Im Vergleich zur Arbeit im Krankenhaus gehe es im stationären Hospiz viel familiärer zu, erklärt Hüben-Rösch. Da die Einrichtung viel kleiner ist, entstehe der Kontakt viel schneller. Wenn Hüben-Rösch ihre Erfahrungen aus der Krankenhausseelsorge mit denen aus dem Hospiz abgleicht, kann sie noch einen grundlegenden Unterschied ausmachen: Im Krankenhaus rücken die Genesung und die Hoffnung darauf in den Vordergrund, im Hospiz ist das Thema Tod wesentlich präsenter. Der Weg ins Hospiz hat für Herrmann etwas von einer Akzeptanz-Äußerung: „Es ist klar, wo er enden wird.“

Die Krankenhaus- und Hospizseelsorgenden gehören zu den mehr als 400 Seelsorgenden der Kategorialseelsorge, die mit Kirchensteuergeldern finanziert werden. Als zusätzliches Budget stehen der Kategorialseelsorge etwa 300.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Bei 100 Euro Kirchensteuer wird etwa ein Euro für die Lebensbegleitung für besondere Situationen und Berufe eingesetzt.
Bericht: Arkadius Guzy, Stabsstelle Mediale Kommunikation der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Mehr zur Verteilung der Kirchensteuer im Dossier.